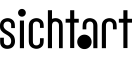von Solmaz Khorsand
Das ist die Rede, gehalten am 19. November 2024 zur Eröffnungsfeier “Wien – Europäische Demokratie-Hauptstadt 2024/25”. Solmaz Khorsand hat mit den Text ihrer Rede zur Verfügung gestellt. Für uns alle! Lest und fühlt am besten selbst.
————————————————
Wien, du alter Punk
Überall provinzelts. An der Wahlurne, in der Kunst, im Feuilleton. Zeit für ein lautes urbanes Bekenntnis aus der einzigen Stadt Österreichs.
Wien ist anders, heißt es oft. Wenn wir, die wir in dieser Stadt leben, diesen Satz sagen, dann meinen wir bekennende Städter, eine Minderheit in diesem Land, etwas komplett anderes, als die vielen Nichtstädter, die die Mehrheit in diesem Land stellen. Was wir mit Stolz postulieren, spucken andere mit Verachtung aus. Wien ist anders. Laut, dreckig, stinkig, kriminell – und so viele Ausländer. Der absolute Alptraum
Nicht umsonst hat die politische Rechte die Stadt als „Frontstellung im politischen Kampf konstituiert“. Das beschreibt der deutsche Humangeograph Johann Braun in seiner Dissertation „Stadt von rechts“. Er analysiert darin sehr anschaulich, welchen prominenten Platz die politische Rechte der Stadt in ihren Untergangsnarrativen einräumt, wie sehr sie den urbanen Raum braucht, diese Großstadt, um das Landleben als homogenen, heteronormativen und nationalistischen Gegenentwurf hochleben zu lassen. Hier am Land, propagieren sie, ist die Welt noch heil. Dort in der Stadt, in der bösen Großstadt mit ihren „heimatlosen, bodenlosen, wurzellosen und beziehungslosen“ Nomaden, die allesamt einer nationalen Selbstverleugnung anheimgefallen sind, nicht. In diesen Kreisen, schreibt Johann Braun, erkennt man die Stadt als „politisches Handlungsfeld, in dem die direkte Konfrontation von rassistischer Exklusion, heteronormativer Restauration und autoritärer Disziplinierung mit liberaler, demokratischer, solidarischer Urbanität möglich scheint.“ In diesen Kreisen gibt es ein Bekenntnis zur Stadt. Es ist ein Antibekenntnis. Ein sehr klares, ein sehr lautes, und ein sehr dominantes. Mal äußert es sich von politischen Leitkulturalistinnen, die zwar auch in der Stadt ihr Zuhause gefunden haben, aber sich beharrlich jeder Urbanität verweigern, wenn sie ihren Mitbürgern mit ihren Programmen ein Wertesystem überstülpen wollen, das in Absolutheit und Monokulturalität nicht provinzieller sein könnte.
Und manchmal äußert sich dieses Antibekenntnis sogar von Kollegen in seriösen Qualitätsmedien. Dann, wenn sie mutig in Wiener Bezirke ausschwärmen als handle es sich um Kriegsgebiete, die sie dann mit dem Blick jener, die tatsächlich immer noch glauben, dass Städte einfach nur größere Dörfer aus der Kindheit ihrer Großeltern sind, präsentieren und alle dort lebenden Menschen wie exotische Tiere ihrem Publikum vorstellen.
Es gibt sie zuhauf diese Antibekenntnisse.
Und ich frage mich: wo ist unser Bekenntnis, in derselben Lautstärke, in derselben Dominanz? Wenn für Antidemokratinnen die Stadt zu einem pervertierten Sehnsuchtsort geworden ist, an dem sie sich so wunderbar reiben können, auf das sie alles Schlechte dieser Welt schieben, alles Dysfunktionale, alles Konfliktbehafte, warum dann nicht für uns, die wir wissen, wie viel an diesen Horrorszenarien dran ist, wie viel wir all das, was sie verabscheuen, bemitleiden oder gönnerhaft exotisieren, wir mit voller Inbrunst feiern. Dass es schon einen Grund hat, warum sich Städte auf der ganzen Welt zu demokratischen Inseln in autoritär versifften Ozeanen entwickelt haben. Weil in der Provinz überall auf der Welt offenbar etwas leichter schlummert und damit leichter mit einer einzigen Gehässigkeit geweckt werden kann, als in der Stadt.
Auch hierzulande.
Ich hatte meine Bestätigung dafür spätestens 2016, am Abend des zweiten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl. Ich saß mit Freundinnen im Schikaneder Kino, in dem die ORF-Sondersendungen zum Wahltag gestreamt wurden. In einem Bericht zeigte der Moderator eine Österreich-Karte nach dem ersten Wahlgang, eingefärbt ausschließlich in den Farben der beiden Kandidaten, die es in die Stichwahl geschafft haben. Diese Karte hat sich eingebrannt. Bis auf Wien, war das gesamte Land in blau gefärbt. Hier war sie vor mir, die kleine Insel in dieser Finsternis von einem Land. Die Insel, wo nicht leicht geschlummert wurde, wo nichts ohne Weiteres geweckt werden konnte, wo rote Linien rote Linien blieben, wo man andere nicht, wie es Michelle Obama jüngst so treffend formulierte, zu Kollateralschäden der eigenen Entscheidungen machen wollte
An diesem Abend schlich sich, wie an so vielen Wahlabenden in Österreich, ein ironischer Gedanke ein, den ich mit Millionen Städterinnen auf der gesamten Welt teile, die genug haben von dieser Mehrheit in der Provinz, die keine roten Linien kennt. Der amerikanische Schriftsteller Paul Auster hat das am ersten Jahrestag des 11. Septembers in einem Essay 2002 für die New York Times beschrieben, als er, der eingefleischte New Yorker und die seinen von den politischen Visionen eines George W. Bushs heimgesucht wurden:
„Vor nicht allzu langer Zeit“, schrieb er, „erhielt ich ein Magazin mit der Post, auf dessen Umschlag stand: „USA OUT OF NYC“. Nicht jeder würde so weit gehen wollen, aber in den letzten Wochen habe ich einige meiner Freunde mit großem Ernst und Enthusiasmus über die Möglichkeit sprechen hören, dass sich New York von der Union abspaltet und sich als unabhängiger Stadtstaat etabliert.
Stadtstaat Wien, why not?
Wie oft haben wir, die wir hier leben, bei Wahlen uns gegenseitig den Satz „Wien ist anders“ nicht aus Stolz, sondern zur Beruhigung zugeflüstert. Weil wir wissen: hier in diesen 0.5 Prozent des Landes, das nicht Provinz ist, sind wir sicher. In Wien zu leben, heißt Österreich in all seiner Provinzialität vergessen zu dürfen. Denn unser Zuhause ist die Stadt. Und das bedeutet: hier ist die Welt zu Hause. Das Alte wie das Junge, das Schöne wie das Hässliche, das Gebildete wie das Ungebildete, das Arme wie das Reiche, das Kranke wie das Gesunde, das Funktionierende wie das Nicht-funktionierende, das Hiesige wie das Dortige. Und alles Dazwischen.
Wir sind geschult darin das zu sehen, und das zu begreifen, weil jede Stadt, die sich als demokratisches Bollwerk verstanden wissen will, diesen Blick schärft und diesem Gefühl Raum gibt. Weil sie weiß, wie elementar dieser Blick und dieses Gefühl für ein demokratisches Grundverständnis seiner Bürgerinnen und Bürger ist. Weil hier in der Stadt der Andere kein leerer Signifikant bleibt, der im schlimmsten Fall, mit allem Schlechten, Gefährlichen, Bedrohlichen aufgeladen ist, ein Fantasma, mit dem sich wunderbar kampagnisieren lässt. In der Stadt ist dieses Gegenüber eine Nachbarin, ein Kollege, eine U-Bahn-Mitreisende, eine Zufallsbekanntschaft. Schlichtweg ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Die Stadt setzt uns auf die niederschwelliste Art einander permanent aus. Und dieser radikalen Begegnungskultur ist es zu verdanken, dass sich dieser Blick und dieses Gefühl, der für eine Demokratie unabdingbar ist, erst entwickeln kann. Erst, wenn wir nicht nur diffus voneinander wissen, sondern einander sehen, miteinander zu tun haben, verpufft jedes Fantasma.
Diese Begegnungskultur ist nur durch Teilhabe möglich. Und Teilhabe äußert sich nicht primär an der Wahlurne, sie äußert sich im Alltag, in den Wohnhäusern, am Arbeitsplatz, in den Schulen – und an den öffentlichen Plätzen. „Wenn die Menschen den öffentlichen Raum nutzen, fördert das den sozialen Zusammenhalt. Das Leben, das sich hier abspielt, ist entscheidend für die soziale Gesundheit einer Gesellschaft“. Das hat mir der dänische Stadtplaner Jan Gehl einmal im Gespräch gesagt. Ich habe ihn vor ein paar Jahren in Kopenhagen interviewt, um ihm die Frage zu stellen: kann uns die richtige Stadtplanung, empathischer, zivilisierter, demokratischer machen?
„Absolut“, hat er gesagt. „Wenn Sie eine Stadt bauen, die nur aus glatten Fassaden und Betonblöcken besteht, wo es viel Lärm in den Erdgeschosszonen gibt und wo Sie als Einziges daran denken können, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, dann fördern Sie keine Empathie. Wenn Sie hingegen Plätze bauen, auf denen man gerne spazieren geht, wo schöne Bäume und Gebäude mit vielen Details in der Fassade stehen; wo Menschen die Möglichkeit haben, vor ihren Häusern selbst Blumen zu pflanzen; wo es Bänke gibt, auf denen sie sitzen können; wo sie jeden Tag die Tür ihres Nachbarn passieren – dann wird schon Empathie gefördert. Sie werden mit der Zeit wissen, wer da wohnt, wer mit wem verheiratet ist, wessen Kinder da herumtollen. Sie werden diese Menschen nicht lieben, aber ein Gefühl dafür bekommen, wer um Sie herum lebt.“ Und das ist entscheidend. Es muss kein aufgezwungenes Miteinander sein, es darf auch ein Nebeneinander sein. Wir müssen einander nicht unsere Lebensentwürfe aufdrängen. Sie dürfen friedlich ko-existieren. Aber es muss eine respektvolle, eine im gegenseitigen Menschsein vollkommen akzeptierende und eine ebenbürtige Ko-Existenz sein.
Eine, in der nicht das eine im Licht im Zentrum glänzen darf, während das andere in die Dunkelheit der Peripherie verdrängt wird. Ein Dasein, segregiert voneinander. Bislang ist Wien das Schicksal vieler großer Städte dank seiner Geschichte erspart geblieben: da die Elendsviertel, dort die Wohlstandsenklaven, Doch immun dagegen ist auch Wien nicht, wie wir aus der Statistik wissen. Auch in Wien nimmt die Segregation zu – und damit der Blick und das Gefühl füreinander ab.
Wer das Privileg hatte, in andere Städte zu reisen, gar dort zu leben, wird vermutlich, wie ich, sehr schnell feststellen, dass Wien, vielleicht nicht so spannend, nicht so inspirierend oder so lebendig ist, aber, dass hier eine Sache vor sehr langer Zeit begriffen wurde: die Verwundbarkeit des Menschen. Dass er jeder jederzeit fallen kann. Dass er alt wird, dass er krank wird, dass er Mist baut, dass er eine zweite, dritte und vierte Chance braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Dass er trotz dieser Verwundbarkeit Träume und Ziele hat, denen er hier nur ein Stück weit näherkommt, wenn er an dieser Stadt teilnehmen darf. Wenn sie ihm offen steht, weil es die Stadt zulässt. Wenn er anderen begegnen darf, und er nicht zum Feindbild wird. Und diese Stadt lässt es zu. Sie versucht es zumindest, auch, wenn es nicht immer klappt. Weil diese Stadt eben nicht nur die grummelige alte Dame ist, die viele von uns kennen, sondern irgendwo auch immer der kleine Punk.
Der Punk, der das Unkontrollierte zulässt, ja es braucht. Und, wenn es einmal zu viel wird, mit Souveränität darauf reagiert, nicht mit Angst oder Hysterie. Wien, der Punk, der von einem unerschütterlichen Humanismus getrieben ist, dessen er sich niemals schämt, egal wie groß der Druck ist. Der, den verwundbaren Menschen, nicht nur nicht vergessen hat, sondern ihn immer noch ins Zentrum seines Handelns stellt. Und – der zugeben kann, wenn er einmal falsch lag. Wenn er das große Ganze einmal nicht im Blick hatte und der verdammt dankbar darüber ist, wenn ihn andere daran erinnern. Etwa, wenn diese anderen nächtelang in Naturschutzgebieten ausharren, um ihn so darauf hinzuweisen, an die Zukunft zu denken, nicht die nächste oder übernächste Wahl oder eine bestimmte Klientel.
Ich bin dankbar für diesen Punk. Ohne ihn wäre das Leben in diesem Land für sehr viele Menschen nicht nur unerträglich, sondern unmöglich. Wien ist anders. Wir, die wir hier leben, ob mit oder ohne Papiere, sagen es nicht unbedingt mit Stolz: wir sagen es viel mehr mit Erleichterung, darüber, dass es diese Insel gibt. Vielleicht wird eines Tages aus dieser Erleichterung ein Bekenntnis. Ein klares, ein lautes, eines, dass es selbstbewusst darauf anlegt, dass die Helligkeit dieser Insel eines Tages auch in diese Finsternis von einem Land leuchtet.
__________________________________
Solmaz Khorsand, geboren 1985 in Wien als Tochter zweier Exiliraner, ist eine österreichische Journalistin und Autorin. Ihre journalistische Arbeit umfasst Reportagen, Essays und Analysen mit Schwerpunkten auf Außenpolitik, Gesellschaft und österreichischer Politik. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Wiener Journalistinnen Preis 2018. Solmaz Khorsand ist zudem Autorin der Bücher Pathos und untertan. Von braven und rebellischen Lemmingen.
“Wien – Europäische Demokratie-Hauptstadt 2024/25”, Büro für Mitwirkung der Stadt Wien